Das Ding unterm Baum
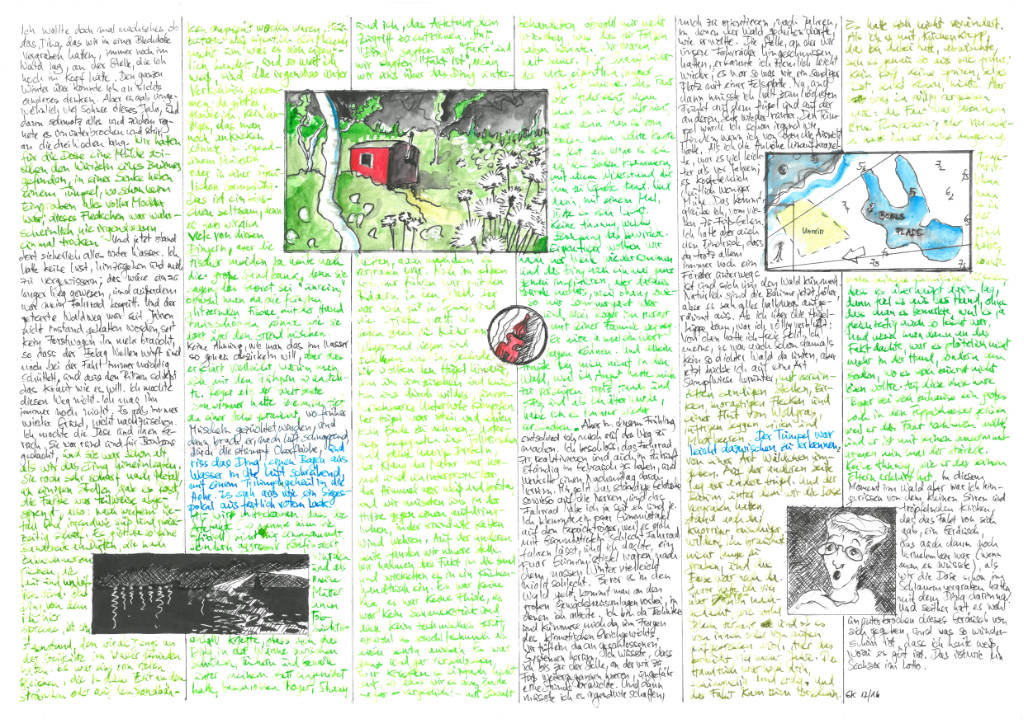
Ich wollte doch mal nachsehen, ob das Ding, das wir in einer Blechdose vergraben hatten, immer noch im Wald lag, an der Stelle, die ich noch im Kopf hatte. Den ganzen Winter über ließ mich der Gedanke nicht los. Aber es gab ungewöhnlich viel Schnee dieses Jahr, und dann schmolz alles, und zudem regnete es ununterbrochen und stur, an die drei Wochen lang. Wir hatten für die Dose eine Mulde zwischen den Wurzeln eines Baumes gefunden, in einer Senke neben einem Tümpel, wo schon beim Eingraben alles voller Modder war; dieses Fleckchen war wahrscheinlich nie irgendwann einmal trocken. Und jetzt stand dort sicherlich alles unter Wasser. Ich hatte keine Lust hinzugehen und mich zu vergewissern; das wäre ein zu langer Weg gewesen, und außerdem war mein Fahrrad kaputt. Und der geteerte Waldweg war seit Jahren nicht instand gehalten worden, seit kein Forstwagen ihn mehr braucht, so dass der Belag Wellen wirft und mich bei der Fahrt immer mächtig schüttelt, und aus den Ritzen schießt das Kraut wie es will. Ich mochte diesen Weg nicht. Ich mag ihn immer noch nicht. Es gab immer wieder einen Grund, nicht nachzusehen. Ich mochte die Dose und ihren Geruch. Sie war rund und für Bonbons gedacht, und sie war schon alt, als wir das Ding hineinlegten. Sie roch sehr scharf nach Metall, an einigen Stellen gab es Rost, die Farbe war teilweise abgesprengt, also: nach weißem Metall und irgendwie süß und gleichzeitig scharf, es gibt da so eine Bandbreite von Düften, die nach Zahnschmerzen riechen, die laut und unhöflich sind. Ich glaube, was ich besonders an dieser Dose mochte, war, sie zuzumachen, so dass sie nicht mehr so nach Metall roch. Das Ding, von dem ich hier spreche, ist ein Gegenstand, den wir als Jungs an der Steilküste im Wasser gefunden hatten. Es war eins von vielen gleichen, die in dieser Zeit an den Stränden oder auf den Sandbänken angespült worden waren. Heutzutage weiß kein Mensch mehr, um was es sich eigentlich handelt, und so weit mir bekannt ist, sind alle irgendwo unter Verschluss gekommen; da gibt es, glaube ich, kein einziges, das man noch ankucken könnte, in irgendeinem Museum oder einer öffentlichen Sammlung. Das ist ein bisschen seltsam, denn es gab wirklich viele von diesen Dingern, aber die Fischer meiden ja heute noch die große Sandbank, denn sie sagen, das Gebiet sei "unrein", obwohl man da die feinsten glitzernden Fische mit der Hand rausschöpfen könnte, wie sie dort über den Grund huschen. Keine Ahnung, wie man das im Wasser so genau abzirkeln will, aber das erklärt vielleicht, warum man sich mit den Dingern so anstellte. Roger als der weltbeste Schwimmer hatte ziemlich tief an einer Stelle getaucht, wo früher Muscheln gezüchtet wurden, und dann brach er, nach Luft schnappend, durch die stumpfe Oberfläche und riss das Ding, einen Bogen aus Wasser in die Luft schreibend, mit einem Triumphgeheul in die Höhe. Es sah aus wie ein Siegespokal aus festlich rotem Lack. Als wir mitbekamen, dass die Artefakte (so nannte man sie offiziell) nicht nur eingesammelt, sondern aggressiv konfisziert wurden und als meine Mutter einen Tobsuchtsanfall kriegte, weil sie entdeckte, dass sich das Ding zwischen Schuhen, Tüchern und Gewölle unter meinem Bett eingeschmiegt hatte, da beschlossen Roger, Shany und ich, das Artefakt dem Zugriff zu entziehen. Statt "Ding" sagte wir "Fakt", und wir sagten "Fakt ist", wenn wir uns über das Ding unterhielten, auch als es vergraben war.
Irgenwann noch im selben Sommer fuhren wir mit den Rädern in den Wald. Der war noch gut in Schuss und die Straße glatt. An einer Stelle kommt man an den Bahndamm; dort muss man das Rad schieben, aber schon damals war die Strecke nur selten befahren und der Wind heulte über die Böschung und um die Kurve, die das Gleis verbarg. Die Leute gingen hier nicht gerne weiter, wir aber schon. Wir waren schon oft hinter dem Damm gewesen, es gab sonst niemanden hier, kilometerweit. Wir ließen dann die Räder am Wegesrand liegen und schlugen uns ins Gelände. Wir wollten den Hügel hinauf, um uns umzusehen und mussten uns durch wildes unvorhersehbares Unterholz kämpfen. Der Hügel war steil und schien kein Ende zu nehmen. Unterwegs begegneten uns Tollkirschen und blauhaarige Disteln, der Klang der Natur war normal und uninterpretierbar. Der Himmel war weiß und brutal und wir mussten uns in der Hitze gegen einen aufdringlichen, in der Grundnote kalten Wind wehren. Im Grunde nichts anderes als der Dosengeruch. Auf der anderen Seite fanden wir unsere Stelle. Wir nahmen das Fakt in die Hand und wickelten es in ein Küchenhandtuch ein. Es war keine Vase, es war keine Phiole, es war kein Schmuckstück und auch kein technisches Gerät, obwohl es sowohl technisch als auch schön aussah. Es war ganz und gar verschlossen, wir kriegten es einfach nicht auf, so dass wir es am Ende sogar – vergeblich – mit Gewalt behandelten, obwohl wir nicht wussten, was das für Folgen haben könnte. Wir waren halt sauer. Nur Shany nicht, der hatte eigentlich immer gute Laune. Auch das Zündeln mit Neujahrsböllern an dem Fakt fand er immer nur super. Es war federleicht, wenn man es in der Luft hielt, aber wenn man es vom Boden heben wollte, klebte es fest, als wolle es sich am Boden klammern, mit allem Widerstand, der ihm zu Gebote stand. Und dann, mit einem Mal, löste es sich weich. Keine Ahnung, welche Bewegung das bewirkte.
Eigentlich wollten wir nach ner Weile wiederkommen und das Ding dann noch einmal ganz genau inspizieren, aber daraus wurde nichts, weil Shany sowieso nur Sommergast war und weil Roger im Herbst mit seiner Familie wegzog. Er hätte ja mal ein Wort sagen können. Und allein traute ich mich nicht in den Wald, weil ich Angst hatte, mich zu verlaufen, trotz Handy und GPS, und als ich älter wurde, habe ich es immer wieder verschoben.
Aber in diesem Frühling entschied ich, mich auf den Weg zu machen. Ich beschloss, das Fahrrad zu reaktivieren und auch in Zukunft ständig in Gebrauch zu haben und werkelte einen Nachmittag daran herum. Mir geht das ständige Gelatsche sowieso auf die Nerven, und das Fahrrad habe ich ja seit eh und je. Ich klemmte ein paar Gummistiefel auf den Gepäckträger, weil es sich mit Gummistiefeln schlecht Fahrrad fahren lässt, und ich dachte, ein paar Gummistiefel wären nach dem nassen Winter vielleicht nicht schlecht. Und das Geräusch, das beim Gehen mit Gummistiefeln entsteht, ist satt und ergiebig, besonders wenn man zielstrebig einen Hang hinunterwandert. Bevor es in den Wald geht, kommt man an den großen Gewächshausanlagen vorbei, in denen ich arbeite. Ich bin da Techniker und kümmere mich um Fragen des klimatischen Gleichgewichts. Wir tüfteln an geschlossenen Systemen herum. Ich wusste, dass ich bis zu der Stelle, an der wir zu Fuß weitergegangen waren, ungefähr eine Stunde brauchte. Und dann musste ich es irgendwie schaffen, mich zu orientieren, nach Jahren, in denen der Wald gedeihen durfte wie er wollte. Die Stelle, an der wir unsere Fahrräder hingeschmissen hatten, erkannte ich ziemlich leicht wieder; es war so was wie ein sandiger Platz mit einer Felsplatte. Na, und dann musste ich halt zum höchsten Punkt auf dem Hügel und auf der anderen Seite wieder runter. Den Tümpel würde ich schon irgendwie finden, wenn ich von oben die Aussicht hatte. Als ich die Anhöhe raufkraxelte, war es viel leichter als vor Jahren; es kostete mich deutlich weniger Mühe. Das kommt, glaube ich, vom vielen Zu-Fuß-Gehen. Ich hatte aber auch den Eindruck, dass da trotz allem immer noch ein Förster unterwegs ist und sich um den Wald kümmert. Natürlich sind viele Bäume jetzt höher, aber es sah alles halbwegs aufgeräumt aus.
Als ich über die Hügelkuppe kam, war ich völlig verblüfft: von oben hatte ich freie Sicht. Ich meine, es war auch damals schon kein so dichter Wald da unten, aber jetzt kuckte ich auf eine Art Sumpfwiese hinunter, mit vereinzelten sandigen Stellen, Birken, morastigen Flecken, und einer Flut von Wollgras, luftigen Seggen, Lilien und Moorbeeren. Der Tümpel war leicht dazwischen zu erkennen, von einer Art Wäldchen umgeben. Auf der anderen Seite lag der andere Hügel. Und der Baum, unter dem wir die Dose vergraben hatten, stand noch da: knorriger, buschiger und wilder. Ich brauchte nicht lange zu graben, und die Dose war noch da. Zuvor hatte ich viel über Korrosion nachgedacht, wie wohl Blech zerfällt und ob es von innen oder von außen aufgefressen wird. Aber das braucht viel mehr Jahre. Das Handtuch war noch drin, schimmelig und erdig. Und das Fakt kann zum Vorschein. Es hatte sich nicht verändert. Als ich es mit Küchenkrepp, das ich dabei hatte, abwischte, sah es genau so aus wie früher. Kein Rost, keine Spuren, selbes Rot, selbes Gefühl, nichts. Aber was ich völlig vergessen hatte: das Fakt hatte sozusagen keine Temperatur, oder vielmehr hatte es immer seine Umgebungstemperatur. Wenn man es in der Hand hielt, konnte man beinahe unmittelbar vergessen, dass es überhaupt darin lag. Dann fiel es aus der Hand, ohne dass man es bemerkte, weil es ja gleichzeitig auch so leicht war. Und wenn man dann an das Fakt dachte, war es plötzlich nicht mehr in der Hand, sondern lag am Boden, wo es sich zuerst nicht lösen wollte. Auf diese Weise hatte Roger bei sich zuhause ein großes Loch in den Teppichbelag gerissen, weil er das Fakt nur hochheben wollte, und er ist mit seinen Schwimmerarmen nun mal der Stärkste. Keine Ahnung, wie er das seinen Eltern erklärt hat. In diesem Moment im Wald aber war ich hingerissen von dem kleinen Sirren und tröpfelnden Klicken, das das Fakt von sich gab, ein Geräusch, das auch dann noch wahrnehmbar war (wenn man es wusste), als wir die Dose schon im Schlamm vergraben hatten, mit dem Ding darinnen. Und seither hat es wohl ununterbrochen dieses Geräusch von sich gegeben, und was so wunderschön ist, ist, dass ich heute weiß, wozu es gut ist. Das ist wie ein Sechser im Lotto.